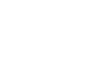Frühe Anzeichen und mögliche Interventionen bei psychotischen Entwicklungen
Ein Vortrag an der Medizinische Hochschule Hannover anlässlich der Tagung "Schizophrenie-Frühintervention und Langzeitbegleitung"
Einleitung
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Psychosen des Kindesalters hat keine sehr lange Tradition. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist vereinzelt auf das Vorkommen kindlicher Psychosen hingewiesen worden.
Bei diesen Beschreibungen handelte es sich allerdings noch nicht um Psychosen, wie wir sie heute verstehen und mit modernen Klassifikationsschemata diagnostisch eingrenzen, sondern um sowohl ätiologisch als auch symptomatologisch ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, so sprach z.B. GÜNTZ (1859) von sog. „Überbürdungspsychosen" des Kindesalters, worunter er psychische Dekompensationsbilder als Folge schulischer „Überbürdung" verstand, heute würden wir sagen Folgezustände von „Schulstress". Erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde von verschiedenen Kinderpsychiatern das Krankheitsbild „kindliche Schizophrenie" klinisch näher umgrenzt. Hier sind in erster Linie die beiden Schweizer Kinder- und Jugendpsychiater Jakob LUTZ und Moritz TRAMER zu nennen. Inzwischen haben sorgfältige klinisch-phänomenologische und verlaufstypologische Untersuchungen die Existenz kindlicher Schizophrenien bewiesen. U.a. durch eigene Langzeituntersuchungen und durch die Verwendung der modernen Klassifikationssysteme (ICD-10, DSM-IV) konnte die nosologische Zusammengehörigkeit schizophrener Psychosen des Kindes- und des Erwachsenenalters belegt werden (EGGERS u. BUNK 1997, 1999). Allerdings: Kindliche Schizophrenien sind selten. Die Prävalenz liegt vor dem 15. Lebensjahr bei 1.4 pro 100.000 (McKENNA et al. 1994). In der Adoleszenz kommt es dann zu einem deutlichen Anstieg der Manifestationsrate mit einem Gipfel zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr (McCLELLAN und WERRY 2001).
Das Hauptrisikoalter einer schizophrenen Erkrankung liegt somit in der Adoleszenz und im jungen Erwachsenenalter. Etwa 77% aller Erkrankungsfälle treten vor dem 30. Lebensjahr auf (HÄFNER & AN DER HEIDEN 2000).
In den letzten Jahrzehnten hat die Verlaufsbeobachtung schizophrener Psychosen aller Altersstufen eine zentrale Rolle gespielt. Dabei ist erstaunlich, dass es nur sehr wenige Langzeitverläufe mit genügend langen Beobachtungszeiten in der Literatur gibt.
In ihrer Meta-Analyse an insgesamt 320 Verlaufsuntersuchungen schizophrener Psychosen des Erwachsenen fanden HERGARTY et al. (1994) nur in 5,7 % Verläufe mit einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von ? 20 Jahren, 57% der Verläufe hatten lediglich eine Katamnesefrist von < 5 Jahren.
In jüngster Zeit hat sich das Interesse auf die frühen Entwicklungsphasen schizophrener Psychosen gerichtet. Speziell geht es um Fragen der Früherkennung und –behandlung. Die Früherkennung der Schizophrenie ist mit Schwierigkeiten verbunden. Zum einen erschwert die individuell sehr variable und vor allem unspezifische Symptomatik in der frühen Phase der Erkrankung die Identifikation der Symptome als Vorboten bzw. Prodromalsymptome einer Schizophrenie (ADAM & LEHMKUHL 2002). Dies gilt in besonderem Maße für schizophrene Psychosen des Kindes- und Jugendalters. Ein diagnostisches Problem stellt hier die entwicklungsabhängige Manifestation schizophrener Symptome dar, denn die Erkrankung beginnt in sehr unterschiedlichen Entwicklungsphasen und die Symptome zeigen ein entsprechendes altersabhängiges Kolorit.
Im Vorfeld einer schizophrenen Psychose sind verschiedene Phasen voneinander zu unterscheiden:
- die prämorbide Entwicklung
- das Prodromalstadium und
- die psychotische Vorphase.
1. Prämorbide Entwicklung
Der Begriff "prämorbid" ist mehrdeutig. Er bezieht sich auf Wesenszüge und Verhaltensauffälligkeiten eines Patienten, welche bereits vor einer eindeutigen psychotischen Episode manifest sind. In der klassischen Schizophrenieliteratur wurde vom "prämorbiden Charakter" gesprochen, ein Begriff, der für Kinder und Jugendliche ungeeignet ist, da deren Persönlichkeitsentwicklung noch in vollem Gang befindlich ist. Im Übrigen können prämorbid beobachtbare Verhaltensauffälligkeiten fließend in Prodrome übergehen bzw. schwer von solchen abgrenzbar sein (PERKINS et al. 2000, YUNG et al. 1996). Aus diesen Gründen verwenden wir den Terminus "prämorbide Entwicklung".
Vor allem anglo-amerikanische Autoren beziehen in ihre Untersuchungen Kinder mit sehr frühem Erkrankungsbeginn mit ein, z.T. liegt das Erkrankungsalter schon im frühen Kleinkindesalter! Insofern nimmt es nicht Wunder, dass diese Autoren prämorbide Symptome einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung (PDD = Pervasive Developmental Disorder) beschreiben, wie Symptome eines Kanner'schen frühkindlichen Autismus, schwere Störungen der psychomotorischen und sprachlichen Entwicklung, fehlende soziale Reagibilität (ALAGHBAND-RAD et al. 1995, ASARNOW 1999, WALKER et al. 1999). Nach unserer Ansicht kann eine Schizophrenie vor dem Alter von 7 Jahren nicht mit genügender Sicherheit diagnostiziert werden. Früher sich manifestierende psychotiforme Syndrome sind dagegen den "nicht näher zu klassifizierenden Psychosen des Kindesalters" zuzurechnen, die nosologisch von echten Frühschizophrenien abzugrenzen sind.
Wir berichten kurz über prämorbide Auffälligkeiten bei katamnestisch gesicherten und diagnostisch eng umgrenzten "Kernfällen" kindlicher Schizophrenien aus unserer Langzeitkatamnese. Die prämorbide Entwicklung von Kindern mit frühem Erkrankungsbeginn lässt sich deshalb gut erfassen, weil die Eltern zeitnah darüber berichten können. Bei den von uns untersuchten Patienten lagen entsprechend detaillierte, plastische und umfassende Beschreibungen in den Krankenakten vor. Das Erkrankungsalter lag zwischen 7 und 14 Jahren. Die Stichprobe der ersten Verlaufsstudie mit einer durchschnittlichen Katamnesefrist von 15 Jahren umfasst 57 Patienten (31 = w, 26 = m). Bei 26 von ihnen (45.5 %) fanden wir keine prämorbiden Auffälligkeiten, die Kinder wurden als kontaktfähig, fröhlich, ausgeglichen, emotional schwingungsfähig, liebevoll, zärtlich, fleißig, lebenslustig, sportlich, ohne neurotische Tendenzen und als gute oder durchschnittliche Schüler mit altersgemäßen Interessen und Hobbies geschildert. 31 Patienten (54,5 %) zeigten dagegen prämorbid bereits Wesenszüge und Verhaltensweisen, die auf Störungen im Kontaktbereich, im Anpassungsverhalten und im Durchsetzungsvermögen hindeuteten. Es handelte sich um kontaktschwache Einzelgänger, zu „Überempfindlichkeit" neigende, übersensible, leicht beleidigte Kinder, die sich ernst, still grübelnd in sich zurückzogen, häufig wenig anhänglich und liebevoll waren, Zärtlichkeiten zurückwiesen, teilweise auch sehr ich-bezogen und eigensinnig oder eigenbrötlerisch-sonderlingshaft und ängstlich waren (siehe Tabelle 1). Vergleichbare prämorbide Auffälligkeiten wurden auch von ALAGHBAND-RAD (1995), HOLLIS (1995), MAZIADE et al. (1996) und MCCLELLAN & MCCURRY (1999) berichtet.
Wie auch in Verlaufsstudien des Erwachsenenalters fanden wir bei der ersten Stichprobe eine positive Beziehung zwischen guter prämorbider Anpassung und Remissionsgrad, prämorbid unauffällige Kinder hatten ungleich bessere Heilungschancen als prämorbid auffällige Kinder.
In unserer 2. Verlaufsstudie an einer verbleibenden Restgruppe von insgesamt 44 der ursprünglich 57 Patienten (Nachbeobachtungszeit: 42 Jahre) verwandten wir die modifizierte Beurteilungsskala zur Einschätzung der prämorbiden Entwicklung (M-PAS). Dabei zeigt sich ein Zusammenhang zwischen schleichendem Beginn, frühem Erkrankungsalter und prämorbiden Auffälligkeiten, bewertet durch die M-PAS .
Kinder mit einem Psychosebeginn vor dem Alter von 12 Jahren weisen bevorzugt einen schleichenden Beginntyp auf und sind prämorbid auffälliger als Kinder, die nach dem 12. Lebensjahr erkranken oder psychotisch werden.
Die M-Pas umfasst 3 Subskalen, welche folgende Bereiche abdecken: Kontaktverhalten (gute Kontaktfähigkeit versus Rückzug), Peer-Beziehungen und Interessen
Da wir die M-PAS für ein unzureichendes diagnostisches Inventar zur Beurteilung von prämorbiden Auffälligkeiten bei schizophrenen Psychosen halten, haben wir eine eigene Skala zur Bewertung prämorbider psychopathologischer Auffälligkeiten entwickelt (EGGERS et al. 2000). Es handelt sich um eine 10-stufige Skala.
Die in Tabelle 3 wiedergegebenen prämorbiden Auffälligkeiten werden größtenteils durch die M-PAS nicht abgedeckt. Sie wurden bei unseren Patienten im Alter zwischen 3 und 10 Jahren beobachtet. Die aufgelisteten Symptome wurden in 10 Kategorien zusammengefasst: Interesseverlust, depressive Verstimmung, Scheu, Paranoia, Ängste, Suizidalität, bizarres Verhalten, Aggression, Isolation und Zwanghaftigkeit.
Unter Zugrundelegung der von uns entwickelten Skala zur Einschätzung der prämorbiden Entwicklung schizophrener Kinder (Premorbid Symptom Checklist, PSCL) kamen wir bei allen 44 Patienten der 2. Verlaufsuntersuchung zu einer ähnlichen Einschätzung der prämorbiden Entwicklung wie bei der 1. Verlaufsuntersuchung: 41 % waren prämorbid unauffällig, 59 % zeigten dagegen Auffälligkeiten in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung (BUNK et al. 2003). Auch in der 2. Nachuntersuchung zeigte sich eine positive Korrelation (r = 38, p < 0.05) zwischen prämorbidem sozialen Rückzugsverhalten mit Scheu und Introvertiertheit einerseits und einer schlechten sozialen Anpassung andererseits, gerated durch die Mannheimer Version der Disability Adaption Scale (M DAS).
Um das umfangreiche 10-Kategorien-System zu verkleinern und wieder zusammenzufassen, wurde eine varimaxrotierte Faktorenanalyse gerechnet. Dabei ergaben sich vier Faktoren, die 75.3 % der Gesamtvarianz aufklären. Ladungen < .40 wurden weggelassen. Wie in Tabelle 4 beschrieben, ließen sich die 10 Items in vier Kategorien zusammenfassen:
- Emotionaler Rückzug und Sensitivität (EWS). Dieser Faktor umfasst die Items Interesseverlust, Depression, Schüchternheit, Suizidalität und Zwänge.
- Existenzielle Ängste (ED). Dieser Faktor umfasst die Items Paranoia, Angst und Suizidalität.
- Offene soziale Fehlanpassung und Feindseligkeit (SMH). Dieser Faktor umfasst die Items bizarres Verhalten und Aggression.
- Vermeidendes Sozialverhalten (SAB), dazugehörige Items sind Isolation und Zwänge.
Auch bei Zugrundelegung der PSCL ergaben sich Zusammenhänge zwischen prämorbiden Auffälligkeiten und Erkrankungsalter einerseits sowie Beginntyp andererseits. Kinder mit einem Erkrankungsalter vor 12 Jahren und mit schleichendem Beginn zeigten signifikant mehr emotionales Rückzugsverhalten, Depression, Introversion und existenzielle Ängste.
Es wurde geprüft, ob ein Zusammenhang besteht zwischen den drei Items der M PAS und psychopathologischen Symptomen, speziell positiven, negativen und oder globalen PANSS-Symptomen zu Erkrankungsbeginn. Dabei ergab sich lediglich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen dem Item "Zurückgezogenheit" und negativen PANSS-Symptomen (s. Tab. 5). Daraus ist zu schließen, dass prämorbid zurückgezogene, introvertierte Kinder zu Psychosebeginn eine negative Symptomatik aufweisen. Auch Hollis (2003) fand einen Zusammenhang zwischen prämorbiden Auffälligkeiten (hohe PAS-Werte) und negativer Symptomatik bei 61 kindlichen und jugendlichen Schizophrenien.
Des Weiteren wurde gefragt nach einem möglichen Zusammenhang zwischen M PAS Items und der relativen zeitlichen Dauer von psychotischen Episoden mit unterschiedlichen DSM IV Diagnosen. Hierzu wurden Korrelationen zwischen den Skalen der M PAS und der relativen Dauer verschiedener Diagnosen im Krankheitsverlauf (Längsschnitt) berechnet. Dabei ergaben sich jeweils statistische Zusammenhänge zwischen den 3 M PAS Items und dem M-PAS-Gesamtscore einerseits und der relativen Dauer der als Schizophrenie entsprechend DSM IV 295.XX diagnostizierten Episoden bzw. Zustände. Das heißt, prämorbid auffällige Kinder weisen im Langzeitverlauf längere Zeiten auf, zu denen sie an einer schizophrenen Psychose leiden. Wie aus Tabelle 6 ersichtlich ist, bestehen zwischen der relativen zeitlichen Dauer von Remissionszuständen und den M PAS Scores negative Korrelationen, das heißt, je stärker ausgeprägt prämorbide Auffälligkeiten sind, um so ungünstiger der Verlauf bzw. die Gesamtprognose.
2. Vorläufersymptome
Vorläufersymptome werden als Prodrome (prodromos, griech. = Vorläufer) bezeichnet. Sie sind als relativ ausgestanzte, der Psychose vorausgehende Verhaltensabweichungen von den beschriebenen prämorbiden Wesensauffälligkeiten abzugrenzen. Dies gelingt allerdings am besten bei akut rezidivierenden Psychosen und relativ schlecht bei schleichend beginnenden, progredient verlaufenden Psychoseformen. Prodrome unterscheiden sich von prämorbiden, emotionalen und behavioralen Auffälligkeiten v. a. durch die Intensität des Symptomenspektrums, welches schließlich eindeutig einen psychotischen Charakter annimmt.
Prodromale Symptome sind relativ unspezifische Phänomene. Psychopathologisch zeichnen sie sich vorwiegend durch eine Negativsymptomatik aus, wie sozialer Rückzug, Interessenverlust, Adynamie, scheue Gehemmtheit, Vernachlässigung der körperlichen Hygiene, bizarre Gedankengänge und läppische Verhaltensweisen, Schlaf- und Appetitlosigkeit, abnehmende Schulleistungen, ungewöhnliches Misstrauen bis hin zu Beziehungsideen („Der schaut mich so komisch an", „Der will mir was", „Alle haben sich gegen mich verschworen"). Es kommt zu gedanklichen Einengungen, die Patienten kommen immer wieder „über denselben Punkt", die Gedanken kreisen um die gleichen Inhalte, bleiben am „Beginn einer Rille" stecken. Die eigene Person und die Umgebung werden als verändert erlebt, alles hat etwas „zu bedeuten". Auch unmotivierte Aggressivität mit Wut- und Zornesausbrüchen und, im Jugendalter, Substanzmissbrauch können vorkommen und u.U. zu einer Fehldiagnose führen.
In der ursprünglichen Stichprobe der ersten Verlaufsuntersuchung wiesen 31 der 57 Patienten (55 %) im Vorfeld ihrer Psychose Prodrome auf. Sie hielten meistens nicht länger als ein bis zwei Wochen, ganz vereinzelt bis zu 8 Wochen und nur einmal 1 Jahr lang an. Größtenteils waren sie einmalig und gingen kontinuierlich in die Psychose über. Es handelte sich dabei um kurz dauernde wahnhaft-depressive oder maniforme Verstimmungszustände, einmal um ein halluzinatorisches Erlebnis mit optischen Halluzinationen und ängstlich-wahnhafter Erregung.
Die Phänomenologie der Prodrome war recht vielfältig. Die häufigsten Symptome bei den 31 Kindern sind in Tabelle 7 aufgelistet.
Prodromal-Symptome entsprechen weitgehend den von HUBER (2002) beschriebenen uncharakteristischen BasisSymptomen. Prämorbide Verhaltensabweichungen, Prodromalerscheinungen und attenuierte psychotische Symptome können ineinander übergehen (PERKINS et al. 2000). Die prodromalen Erscheinungen können entweder kontinuierlich in die akute psychotische Episode einmünden oder Tage bis Wochen oder sogar Monate der akuten Phase vorausgehen. Prodrome können als sog. Vorpostensyndrome in Form von eigenständigen, zeitlich umgrenzten psychpathologischen Zustandsbildern der Psychose in einem Zeitabstand von bis zu mehreren Jahren vorausgehen. Dies konnten wir bei 3 von 11 Kindern mit einem Psychosebeginn vor dem 11. Lebensjahr beobachten, die Vorpostensyndrome traten jeweils im Alter von 6, 7, und 8 Jahren auf und hielten einige Wochen bis Monate an. Das Intervall bis zur ersten psychotischen Episode lag bei diesen Kindern zwischen 3 und 8 Jahren (EGGERS et al. 2000).
In der Querschnittbetrachtung ist die adäquate Bewertung und korrekte Klassifizierung von Prodromalerscheinungen bei Kindern und Jugendlichen äußerst schwierig, eine Schwierigkeit, die keinesfalls unterschätzt werden darf! Die eindeutige Zuordnung von ungewöhnlichen Verhaltens und Wesensauffälligkeiten als Prodromalerscheinungen ist letztlich nur retrospektiv möglich, nämlich nach der Manifestation eindeutiger psychotischer Symptome! Immerhin konnten in der Mannheimer ABCStudie mit dem IRAOS, einem Instrument zur retrospektiven Erfassung des frühen Psychoseverlaufs, bei 4 % der untersuchten Patienten Prodromalsymptome schon vor dem 10. Lebensjahr belegt werden (HÄFNER et al. 2002).
Die Schwierigkeit, eine beginnende schizophrene Psychose zu diagnostizieren, zeigt sich auch in den üblicherweise langen Zeitstrecken mit unterschiedlichsten psychiatrischen Diagnosen und Behandlungsversuchen im Vorfeld der korrekten Diagnosestellung bei schizophrenen Erkrankungen. SCHAEFFER und ROSS (2002) belegen dies sehr eindrücklich in ihrer empirischen Studie zu den Krankengeschichten von an einer Frühschizophrenie erkrankten Patienten. Vor der endgültigen Diagnosestellung bekamen die 17 Kinder, deren Krankengeschichten analysiert wurden, 43 verschiedene Diagnosen wie Entwicklungsverzögerung, ADHD, bipolare und depressive Störungen, Zwangsstörungen, generalisierte Angststörungen und Störung des Sozialverhaltens. Es wurde eine breite Palette psychotroper Medikamente angewendet, darunter Stimulantien, Antidepressiva, Lithium, Clonidin und Neuroleptika. Sechs der 17 Patienten, also mehr als ein Drittel, wurden ausschließlich mit Massagen, Kamillebädern oder mit pflanzlichen Mitteln behandelt. In Übereinstimmung mit Befunden anderer Autoren (vgl. LARSEN et al. 2001) vergingen im Durchschnitt 2 Jahre zwischen dem Auftreten der ersten psychotischen Symptome und der korrekten Diagnose und Behandlung der Störung. Den ersten Kontakt mit einem Arzt / Psychologen hatten die Patienten durchschnittlich 2.5 Jahre vor dem Auftreten der akuten psychotischen Symptome. Eine frühere Identifikation von Risikopatienten wäre also in vielen Fällen möglich gewesen.
3. Diagnostisches Vorgehen
Diagnostisches Vorgehen zur Beurteilung des Frühverlaufs von Psychosen
Die eleganteste und aussagekräftigste Vorgehensweise zur Erfassung von Frühsymptomen sind prospektive Längsschnittuntersuchungen. Sie sind allerdings mit Schwierigkeiten verbunden: Man braucht einen „langen Atem". Am besten geht man von einer bestimmten Grundpopulation zu einem definierten Zeitpunkt aus. Am sinnvollsten sind Geburtskohorten eines bestimmten Zeitraums, welche dann in regelmäßigen Abständen von Geburt an bis zum Zielzeitpunkt möglichst von denselben Forschern nachuntersucht werden (z.B. CANNON et al. 2002).
Bei zwei rezenten prospektiven Längsstudien, bei denen in regelmäßigen Intervallen (kinder-)psychiatrische Verlaufsuntersuchungen bis ins Erwachsenenalter hinein durchgeführt wurden (CANNON et al. 2002, POULTON et al. 2000) ergaben sich folgende Prädikatoren für eine Psychose im Erwachsenenalter :
- ungewöhnliches Misstrauen
- Hohe Sensitivität
- Soziales Rückzugsverhalten und
- Selbstberichte über abstruse Vorstellungen und
Wahrnehmungen im Kindesalter
In einer groß angelegten, über vier Dekaden sich erstreckende britische Kohortenstudie an 5.362 Individuen, die zwischen dem 03. und 09. März 1946 geboren wurden, haben JONES et al. (1994) prospektive Daten zu jeweils 11 Messzeitpunkten bis zu einem Alter von 16 Jahren erhoben. Bei Kindern, die später, zum Teil erst im Erwachsenenalter eine Schizophrenie entwickelten, konnten die Autoren folgende Auffälligkeiten in unterschiedlichen kindlichen Entwicklungsphasen feststellen:
- eine verzögerte motorische und sprachliche Entwicklung,
- eine Tendenz zu Rückzug und Einzelgängertum im Alter von vier bis sechs Jahren
- soziale Unsicherheit mit 13 Jahren und
- schlechtere Schulleistungen im Vergleich zur Altersgruppe.
Im Alter von 15 Jahren wurden die Kinder, die später eine Schizophrenie entwickelten, von den Lehrern als auffallend ängstlich eingestuft. Im Alter von 8, 11 und 15 Jahren wiesen diese Kinder gegenüber der Altersnorm niedrigere IQ-Werte auf.
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten DONE et al. (1994) in einer Kohortenstudie bei 7 - 11-jährigen Kindern, die später an Schizophrenie erkrankten. Die Ergebnisse der finnischen Kohortenstudie stützen diese Befunde (Übersicht bei ISOHANNI et al. 2000). DONE et al. (1994) fanden darüber hinaus Geschlechtsunterschiede: Jungen zeigten mit elf Jahren ein überreaktives acting out Verhalten, während Mädchen in diesem Alter eher ein gegenteiliges Muster sozialer Fehlanpassungen aufwiesen, sie waren zurückhaltend, weniger mitteilsam, gehemmt und sozial zurückgezogen.
Zusammenfassend lassen sich somit in der Vorgeschichte von im Erwachsenenalter erkrankten Patienten psychosoziale und emotionale Verhaltensabweichungen auf der einen und kognitive Beeinträchtigungen auf der anderen Seite feststellen. Letztere gehen z.T. mit sprachlichen, perzeptiven und motorischen Entwicklungsstörungen einher.
4. Frühwarnzeichen
In der neueren Forschung zu Vorläufersymptomen schizophrener Psychosen des Erwachsenenalters wird zwischen sog. „psychosefernen" und „psychosenahen" Prodromen unterschieden. Unter psychosenahen Vorläufersymptomen versteht man abgeschwächte psychotische Symptome wie paranoide Vorstellungen, extremes Misstrauen, Beziehungsideen, die der psychotischen Symptomatik sehr ähnlich sind und in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem vollen Ausbruch der Psychose stehen.
Bei 23 Probanden (52.3 %) der Stichprobe unserer zweiten Verlaufsuntersuchung (n = 44) konnten wir solche psychosenahen Prodrome beobachten, die Verteilung ist in Tabelle 8 dargestellt.
In jüngster Zeit zentriert sich das Forschungsinteresse auf die Frage, ob sich möglichst lange Zeit vor dem eigentlichen Ausbruch der Psychose sog. Frühwarnzeichen herausarbeiten lassen, deren rechtzeitige Diagnose zu einer Verkürzung des der Psychose vorausgehenden Intervalls führen könnte. Durch eine Abkürzung der unbehandelten Periode (= DUP, Duration of Untreated Psychosis) erhofft man sich eine Verbesserung der Gesamtprognose. In unserer Stichprobe von 44 zum 2. Mal nachuntersuchten Patienten mit einer durchschnittlichen Gesamtbeobachtungsdauer von 42 Jahren zeigte sich, dass das Intervall zwischen dem Alter bei erstem Auftreten unspezifischer psychiatrischer Symptome und dem Zeitpunkt mit eindeutig psychotischen Symptomen länger war, als das Intervall zwischen dem Auftreten eindeutiger psychotischer Symptome und der Ersthospitalisation (1,4 Jahre versus 4 Monate). Bei den jugendlichen Psychosen (n = 44) lagen die Verhältnisse umgekehrt (s. Tab. 9).
Ob die modernen bildgebenden Verfahren im Bereich hirnstruktureller Aberrationen auch für die Früherkennung nutzbar gemacht werden können, hängt entscheidend von der Frage ab, ob solche Auffälligkeiten Ursache oder Folge der Erkrankung sind. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Hirnanomalien überwiegend schon vor Ausbruch der Erkrankung entstanden sind und im Krankheitsverlauf stabil bleiben. Womöglich stehen solche Anomalien mit frühen Hirnschädigungen bzw. neuronalen Entwicklungsstörungen in Zusammenhang, da in der Krankheitsvorgeschichte der Betroffenen gehäuft Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen sowie frühkindliche Hirnkrankheiten vorkommen. Lediglich eine kleine Gruppe der Erkrankten zeigt ein langsames Fortschreiten der Hirnveränderungen (KUMRA et al. 2000). Ob es sich hierbei um eine eigenständige Untergruppe handelt, kann derzeit noch nicht sicher bestimmt werden.
Um den Bereich von hirnstrukturellen Aberrationen für die Früherkennung praktisch zu nutzen, muss erst noch erforscht werden, inwieweit diskrete Normabweichungen in bildgebenden Befunden im Vergleich mit gesunden Personen als spezifische Indikatoren für eine spätere schizophrene Psychose anzusehen sind. Wenn später erkrankende Personen sich hier schon früh von Gesunden unterscheiden, könnte dies zu einer Verbesserung der Früherkennung führen.
Die erwähnten hirnstrukturellen Veränderungen sind zum Teil durch pränatale Migrationsstörungen neuronaler Zellen in subkortikalen und kortikalen Strukturen bedingt. Hierfür werden sowohl erbgenetische Einflüsse als auch prae- und perinatale Sauerstoffmangelzustände verantwortlich gemacht.
5. Frühintervention
Ein großes Problem stellt die Spezifizierung sog. Frühsymptome und Frühwarnzeichen vor Beginn einer Psychose dar. Gerade für Kinder und Jugendliche sind sie als unspezifisch anzusehen. Die geringe Spezifität und nur mäßige prognostische Valenz von Risikobedingungen und Frühwarnzeichen lassen eine verantwortbare Aussage über die Wahrscheinlichkeit einer psychotischen Erkrankung im Einzelfall keineswegs zu.
Auch MALLA und NORMAN (2002) und WARNER (2001) kommen in ihrer kritischen Bewertung entsprechender Studien zu dem Schluss, dass wegen der Unspezifität der Symptome in der Prodromalperiode das Risiko, zu falsch positiven Ergebnissen zu kommen, relativ hoch ist.
Darüber hinaus können frühzeitige therapeutische Interventionen zum Auftreten von sehr unerwünschten Nebenwirkungen führen, so dass die Entscheidung zu einer Frühbehandlung äußerst kritisch und behutsam zu treffen ist. Nutzen und Risiko der Behandlung sind besonders sorgfältig abzuwägen. Auch ethische Aspekte sind dabei zu berücksichtigen, wie z.B. eine vorzeitige Beunruhigung und Stigmatisierung des Patienten und seiner Angehörigen!
Bislang gibt es noch keine überzeugende kontrollierte Studie, die die Wirksamkeit von Frühinterventionen bei schizophrenen Psychosen belegen würde! Dies ist auch das Ergebnis von LARSEN et al. (2001). Die Autoren unterziehen mehrere Früherkennungs- und Frühinterventionsstudien einer kritischen metaanalytischen Evaluation und kommen jeweils zu dem Schluss, dass bisher keine eindeutigen, methodisch sauberen und überzeugenden Studien vorliegen, welche Sinn und Nutzen einer Frühintervention eindeutig belegen! Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch MALLA und NORMAN (2002).
Entgegen der allgemeinen Euphorie in Bezug auf die Früherkennung schizophrener Psychosen ist gerade bei Kindern, deren Verhaltensrepertoire als pluripotent anzusehen ist, äußerste Vorsicht und Zurückhaltung angebracht. Kinder, die eingangs beschriebene prodromale unspezifische Verhaltensauffälligkeiten zeigen, entwickeln nur ganz selten eine psychotische Erkrankung, und es wäre verheerend, diese Kinder alle als potentiell psychosegefährdet anzusehen und einem Screeningverfahren zu unterwerfen! Bislang bewegt man sich hier zwischen Skylla und Charybdis: zwischen möglichem jedoch ungesichertem Nutzen und unnötiger und ungerechtfertigter Verunsicherung von jungen Patienten und deren Angehörigen. Besonders in der Pubertät, Früh- und Spätadoleszenz stellen Unsicherheiten über das Hineinwachsen in die Erwachsenenrolle, Überforderungen durch ungelöste Autonomie- und Loslösungskonflikte, Unsicherheiten der psycho-sexuellen Identität und Schwierigkeiten beim „Abstreifen der Kinderschuhe" alterstypische Probleme dar, welche auf der Verhaltensebene zu unspezifischen Irritationen führen können, wie starke Selbstzweifel, sozialer Rückzug, Kontaktschwierigkeiten, soziale Ängste, Leistungsversagen, alles Symptome, die auch im Vorfeld schizophrener Psychosen auftreten können. Sinnvoll ist eine behutsame und taktvolle Beobachtung solcher Kinder, keineswegs aber therapeutische Schnellschüsse, vor allem nicht mit nebenwirkungsreichen Psycho-pharmaka! Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass wir so gut wie nichts wissen über die langfristigen Auswirkungen sowohl typischer als auch atypischer Neuroleptika auf das noch in Entwicklung befindliche kindliche und jugendliche Gehirn.
Trotz dieser Einschränkungen ist es jedoch angebracht, möglichst frühzeitig Risikogruppen zu erfassen und in regelmäßigen Intervallen zu untersuchen und ggf. nach dem sog. psychoedukativen Modell zu behandeln (familiäres Krisenmanagement, Stressbewältigung, Verbesserung der Coping-strategien, rechtzeitiges Erkennen von Frühwarnzeichen, etc.). Dieses präventive Modell entspricht weitgehend dem Programm der poststationären Weiterbehandlung schizophren Erkrankter mit dem Ziel der Rückfallverhütung und der behutsamen Reintegration in den Alltag.
6. Prävention
Einer der wichtigsten Befunde der prospektiven Studie von JONES et al. (1994) war, dass die Mütter der später schizophren Erkrankten deutlich verringerte mütterliche Kompetenzen zeigten und in ihrem Verständnis für ihr Kind beeinträchtigt waren. Bei ihnen wurde eine verminderte Empathiefähigkeit und ein unzureichendes Erziehungsverhalten festgestellt. Das Fehlen stützender intimer Beziehungen korrelierte stark mit der Chronizität der kindlichen Störung. Ferner wurden Brüche im Familienleben, in den sozialen Beziehungen und in der beruflichen Tätigkeit von Eltern schizophrener und depressiver Kinder beschrieben. Ebenso wie JONES et al. (1994) haben auch CANNON et al. (2002) und MYHRMAN et al. (1996) Interaktionsstörungen zwischen Mutter und Kind in der Vorgeschichte später an einer Schizophrenie erkrankten erwachsenen Probanden beschrieben.
Aus diesen Befunden ist zu folgern, dass die Förderung elterlicher Kompetenzen und interaktiver Fähigkeiten sinnvoll ist. In sicheren und haltgebenden Beziehungen aufwachsende Kinder haben größere Chancen, sich zu selbstsicheren und autonomen Persönlichkeiten weiter zu entwickeln, wie dies die Ergebnisse der Bindungsforschung eindrucksvoll belegt haben (Einzelheiten s. bei ZIEGENHAIN 2003). Evaluationsstudien haben zeigen können, dass durch frühe behutsame Beratung die elterliche Feinfühligkeit verbessert und die interaktive Kompetenz junger Eltern gestärkt werden kann. Auch die Untersuchungen von RAINE et al. (2003) haben zeigen können, dass ein präventives Frühförderprogramm im Kleinkindesalter sich präventiv u.a. auf das Entstehen schizotypischer Persönlichkeitszüge im Alter zwischen 17 und 23 Jahren auswirken kann. Diese allgemeinpräventiven Maßnahmen sind natürlich nur von geringer Spezifität, so sinnvoll sie auch für die individuellen Entwicklungschancen des Kindes sind.
7. Fazit
Wir sind mit JONES und TARRANT (1998, 1999) der Ansicht, dass die fehlende Spezifität von Vorläufersymptomen und Entwicklungs-abweichungen und die Überschneidungen mit anderen Krankheitsrisiken „bis heute keine praktikable Früherkennung einer zukünftigen Erkrankung auf individueller Ebene" erlauben. Auch ISOHANNI et al. (2000) kommen aufgrund ihrer prospektiven Langzeitstudie an einer Geburtskohorte von insgesamt 12.058 Lebendgeburten zu dem Ergebnis, dass keines der von ihnen beschriebenen prämorbiden Symptome und Risikofaktoren sich als spezifisch für die spätere Entwicklung einer schizophrenen Psychose erwiesen hat und irgendwie geeignet wäre, das Risiko für eine Schizophrenie in der Allgemeinbevölkerung vorauszusagen.
Kinder, die sich in ihrem Verhalten deutlich verändern ohne hinreichenden Grund, sollten jedoch dem Kinder- und Jugendpsychiater vorgestellt werden, nach dem Motto: „lieber einmal zu viel als einmal zu wenig". Wenn Verhaltensauffälligkeiten wie Kontaktstörungen, Neigung zu sozialem Rückzug, ungewöhnliche Denkinhalte, starke Ängstlichkeit, ungewöhnliches Misstrauen, abnorme Gedankeninhalte, ausgeprägte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen und unerklärliches, grundloses aggressives Verhalten vorliegen, sollten die Betroffenen besonders sorgfältig, regelmäßig und behutsam nachuntersucht und weiterbetreut werden, ohne sie vorzeitig zu stigmatisieren und zu beunruhigen.
Ein graphischer, modellhafter Überblick über Risikofaktoren, Frühsymptome, Prävention und Therapie ist in Abb. 4 wiedergegeben.